Schulung zur landwirtschaftlichen Kompostierung im Rahmen des EIP-Projektes „Verbund landwirtschaftliche Kompostierung (VELKO)“
Das Projekt
Das dreijährige Projekt (April 2021 – Dezember 2023) "Verbund landwirtschaftliche Kompostierung (VELKO)“ organisiert einen Arbeitsverbund zur dezentralen landwirtschaftlichen Kompostierung. Es wird aus Mitteln der Europäische Innovationspartnerschaft (EIP) finanziert und ist bei der Stiftung Ökologie & Landbau (SÖL) als verantwortliche Koordinationsstelle angesiedelt. Insgesamt sind sechs landwirtschaftliche Betriebe in der Region Pfalz und Rheinhessen, das Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau (KÖL) am Dienstleitungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Bad Kreuznach sowie die Universität Stuttgart an dem Vorhaben beteiligt. Unterstützend steht außerdem die Fachberatung des Humus- und Erden Kontor sowie des Ingenieurbüros für Sekundärrohstoffe und Abfallwirtschaft (ISA) zur Seite.
Im Kern zielt das Projekt darauf ab, die Hürden zu bewältigen, die bislang der landwirtschaftlichen Kompostierung im Wege stehen. Den beteiligten landwirtschaftlichen Betrieben soll im Rahmen des Projektes sowohl die Technik, als auch die Überwachung und Beratung für eine erfolgreiche dezentrale Kompostierung zur Verfügung gestellt werden.
Ein weiteres wesentliches Anliegen des Projekts ist der Wissenstransfer an weitere Betriebe, damit die Möglichkeiten der ordnungsgemäßen und qualitativ hochwertigen Kompostierung auch nach dem Projektende in der Region fortgesetzt werden können. Darüber hinaus soll das Projekt einen Beitrag leisten, um die Durchführung der Kompostierung qualitativ zu verbessern und die damit potentiell verbundenen Umweltbelastungen zu minimieren.
Kompostieren will gelernt sein!
„Kompostieren lernen“, das war das Ziel der ersten Schulung Anfang März 2022 im Rahmen des EIP-Projektes „VELKO“. Marion Bieker und Falk Neumann vom Humus- und Erden Kontor (Entwicklungs- und Handelsgesellschaft mbH) und Ralf Gottschall vom Ingenieurbüro für Sekundärrohstoffe und Abfallwirtschaft (ISA) vermittelten den insgesamt 20 Teilnehmer*innen aus Landwirtschaft und Weinbau die Grundlagen der Kompostierung. Im zweiten Teil der Schulung ging es um die Beurteilung der Zusammensetzung der Ausgangsmaterialien sowie der Qualität des fertigen Kompostes. Zum Abschluss konnten die Teilnehmer*innen die neuen Erkenntnisse in einem Praxisteil auf mehreren Projektbetrieben anwenden und erproben. Neben Theorie und Praxis sollten jedoch auch die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch zwischen Praxis und Beratung nicht zu kurz kommen!
Die Kompostierung beschreibt die Lenkung von Prozessen
Zu Beginn der Schulung stellten Marion Bieker und Ralf Gottschall die Grundlagen des Kompostierungsprozesses – auch Rotte genannt – vor. Im Großen und Ganzen kann der Rotteprozess in drei Phasen eingeteilt werde. In der ersten Phase – der Abbauphase – steigt schon innerhalb weniger Tage die Temperatur im Kern der Kompostmiete auf bis zu 60°C an. Sie zeichnet sich durch eine hohe Abbauaktivität durch Bakterien und Pilze aus. Diese erste Phase der Rotte ist eine Art „Reinigungsprozesse“, da durch die hohen Temperaturen eine Hygienisierung des Materials erfolgt. Unkrautsamen werden weitestgehend unschädlich gemacht und bodenbürtige Keime werden zerstört. Durch die hohen Temperaturen trocknet die Kompostmiete außerdem kontinuierlich ab. Ausgasungen von Ammoniak (NH3) können in dieser Phase vorkommen. Diese Stickstoffverluste gilt es durch geeignete Maßnahmen möglichst gering zu halten. Beispielsweise kann durch eine Vlies-Abdeckung der Miete sowie die Wahl des richtigen Ausgangsmaterials mit einem weiten C:N-Verhältnis (Optimum 25-35:1) und einem nicht zu hohen pH-Wert (Optimum ca. pH 7) dieser Stickstoff-Verluste möglichst gering gehalten werden.
Nach der Abbauphase folgt die Umbauphase. Die Zahl der Bakterien geht zurück und es kommen vermehrt Pilze beim weiteren Abbau von Lignin und dem Aufbau von Huminsäuren zum Einsatz. In diesem Abschnitt der Kompostierung sinkt die Temperatur der Miete wieder ab, eine stabile Mikroorganismenpopulation entsteht und der Kompost verfärbt sich aufgrund der Bildung von Huminstoffen zunehmend dunkler. Das Ergebnis ist der sogenannte „Frischkompost“ mit einer hohen Düngewirkung.
Die anschließende Aufbau- oder Reifephase wird auch als Abkühlungsphase bezeichnet, da hier die Temperaturen auf unter 20°C absinken. Es findet kein weiterer Um- oder Abbau statt und das mikrobielle und pilzliche Wachstum nimmt weiter ab. Nährhumus wird zu Dauerhumus, die Düngewirkung wird schwächer, die Humuswirkung jedoch besser. Nun spricht man von einem „Fertigkompost“.
Wie lange genau die einzelnen Phasen des Rotteprozesses andauern, kann nicht pauschal festgelegt werden, da der Rotteprozess bzw. die Rottequalität von vielerlei Faktoren abhängig ist. Die Feuchte und Art des Ausgangsmaterials, der Mikrobenbesatz, die Temperatur, das Management wie die Häufigkeit des Umsetzens der Miete, Abdeckung (ja/nein), die Bewässerung und vielem mehr. Grundsätzlich lässt sich der Rotteprozess aber i.d.R. gut über das Management wie umsetzen, abdecken und/oder bewässern steuern.
Die Analyse ist nur so gut, wie die gezogene Probe! - Die richtige Probennahme
Im Anschluss an den theoretischen Teil folgte eine Demonstration der korrekten Probennahme an der im Oktober 2021 aufgesetzten Kompostmiete des Gerbachhofs (Ausgangsmaterialien: Untersaat aus Getreide inkl. Stoppeln & Hühnertrockenkot) durch Falk Neumann. Für eine repräsentative Probe ist es wichtig, möglichst aus der Kernzone der Miete gleichmäßig über die gesamte Länge verteilt mehrere zufällige Stichproben zu entnehmen. Die Ausgangsprobe sollte aus ca. 60-100 Liter Material bestehen. Durch mehrmaliges gründliches Mischen der Probe auf einer Plane und dem Verwerfen von Teilen der Probe wird diese auf ca. 20 Liter reduziert. Diese Probe wird dann für eine Analyse eingeschickt. Gewissenhaftes Arbeiten und ein bisschen Liebe bei der Probennahme zahlen sich am Ende in einem aussagekräftigen und repräsentativen Ergebnis aus!
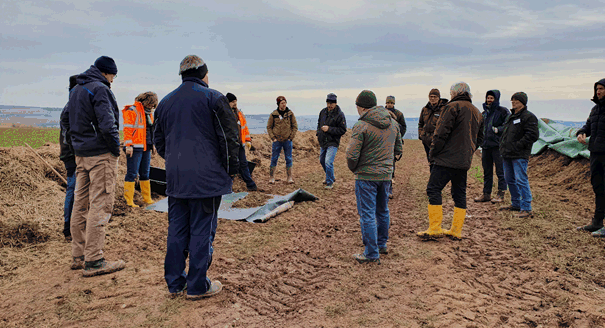
Zu feucht, zu kalt oder doch ganz gut? – Beurteilung des Kompostqualität
]Unter dem Titel „Die Bonitur als Lern- und Erfahrungsinstrument“ folgte nach einer kurzen Stärkung der praktische Teil der Schulung. Nun waren auch die Teilnehmer*innen gefragt. An unterschiedlichen Mieten auf zwei weiteren Projektbetrieben hieß es in Gruppenarbeit die Theorie des Vormittags bei der Bonitur verschiedener Kompostmieten anzuwenden und zu üben.
Angefangen auf dem Nackterhof in Neuleiningen, einem Bio-Ackerbaubetrieb mit Pensionspferdehaltung. Auf diesem Betrieb ging es um die Veranschaulichung des Einflusses unterschiedlicher Ausgangsmaterialien bzw. Mischungsverhältnisse auf den Ablauf des Rotteprozesses. Drei Mieten sollten begutachtet und bonitiert werden: Miete 1 aus 100% Pferdemist, Miete 2 aus 2/3 Pferdemist und 1/3 Kleegras, Miete 3 aus 50% Pferdemist und 50% Kleegras. Vor dem Aufsetzen der Kompostmieten wird der Pferdemist des Betriebes ca. 2-3 Monate in einem Fahrsilo auf dem Hof gesammelt und vorgerottet. Seit dem Aufsetzen der Mieten im November 2021 wurden diese insgesamt drei Mal gewendet. Eine Bewässerung erfolgte lediglich bei den Mieten, die aus einer Kleegras-Pferdemist-Mischung bestanden. In Kleingruppen wurde von allen drei Mieten das fertige Kompostmaterial untersucht, analysiert und anschließend mit Hilfe eines Boniturbogens beurteilt. Die Ergebnisse wurden im Anschluss an die Gruppenarbeit in der gesamten Runde besprochen und diskutiert.[

Abbildung 2: Übung zur Beurteilung der Kompostqualität (Geruch, Feuchte, Verpilzung) auf dem Nackterhof
Zwischen den drei Mieten zeigten sich z.T. deutliche Unterschiede. Je höher der Kleegrasanteil, desto weiter fortgeschritten war der Rotteprozess. Miete 3 (Mischungsverhältnis 50:50) zeigte einen fertigen Kompost mit einer homogenen Zusammensetzung, während die 100%-Pferdemist-Miete noch eine etwas gröbere Struktur aufwies. Die Temperaturmessungen ergaben bei allen drei Mieten Werte um die 10°C was darauf hindeutet, dass keine Umsetzung mehr stattfindet. Die Faustprobe (etwas Material wird in die Hand genommen und fest zusammengepresst - tritt Feuchtigkeit zwischen den Fingern hervor, ist das Material zu feucht) zeigte bei Miete 3 , dass der Feuchtgehalt des Substrates für den bereits weit fortgeschrittenen Rotteprozess etwas zu hoch war (siehe Abbildung 2 – „Ballenbildung“). Dies kann jedoch an den starken Niederschlägen und dem Sturm der vorangegangenen Tage gelegen haben. Eine Zonierung (Basis – Kernzone – Randzone) war nicht mehr zu erkennen. Anders bei Miete 2 mit einem Kleegrasanteil von 1/3. Hier ließ sich noch eine leichte Abgrenzung der einzelnen Zonen erkennen, sowie eine leichte Verpilzung der verhältnismäßig trockenen Kernzone. Was jedoch nach Aussage der Schulungs-Veranstalter Marion Bieker und Ralf Gottschall nicht weiter schlimm ist, die Komposte habe trotz alledem einen hohes Wasserbindevermögen und könne bereits ausgebracht werden. Lediglich die Ausbringung könne durch die erhöhte Feuchtigkeit etwas erschwert werden. Auch in dieser Miete waren die Umsetzungsprozesse anhand der niedrigen Kerntemperatur bereits weitestgehend abgeschlossen.

Abbildung 3: Unterschiedliche Ausgangsmaterialien bei selber Kompostierungsdauer (links: 50% Kleegras, 50% Pferdemist; rechts: 1/3 Kleegras, 2/3 Pferdemist)
Alles in allem zeigte sich auf diesem Projektbetrieb, dass die Rotte des Pferdemistes durch die Zugabe des Kleegrases nochmal in Gang gesetzt wurde und den Prozess beschleunigt hat. Dies bestätigten auch die Analyseergebnisse des Ausgangsmaterials: der reine Pferdemist hatte mit 16,4 das geringste C:N-Verhältnis, im Vergleich zur Mischung mit 1/3 Kleegras mit 26,5 und der 50:50-Mischung mit einem C:N-Verhältnis von 24. Letztere Miete zeigte auch den höchsten Wassergehalt mit ca. 70% durch den hohen Anteil an (feuchtem) Kleegras. Der Optimalbereich des C:N-Verhältnisses sollte bei Beginn der Rotte im Ausgangsmaterial bei etwa 25-35:1 liegen. Je höher das C:N-Verhältnis ist, desto langsamer ist der Rotteprozess. Ist es zu niedrig, kommt der Rotteprozess nur schwer in Gang.
Zum Abschluss der Schulung stand eine letzte Übung auf dem Kleinsägmühlerhof der Lebenshilfe Bad Dürkheim auf dem Programm. Die „wilde Mischung“ besteht aus allem, was auf dem Betrieb an kompostierbarem Material anfällt – u.a. aus Mist jeglicher Art mit einem hohen Strohanteil (Pferd, Rind, Schwein und Geflügel), Hackschnitzeln und Grünschnitt. Im vergangenen Sommer wurde die Miete einmalig mit Gülle „bewässert“ und insgesamt dreimal umgesetzt. Da die Miete nach und nach immer wieder ergänzt wurde mit unterschiedlichen Ausgangsmaterialien zeigten sich hier deutlich Unterscheide in der Qualität und Zusammensetzung des fertigen Kompostes. Zum Beispiel erwies sich der Teil der Kompostmiete, der ausschließlich aus Tiefstreumaterial bestand, anhand der Faustprobe als deutlich zu nass, während andere Abschnitte mit einer ausgewogeneren Mischung eine deutlich bessere Qualität zeigten. Neben der bereits fertigen Miete würde einige Tage zuvor noch eine neue „Versuchsmiete“ für die Untersuchungen im Rahmen des Projektes aufgesetzt. Bei dieser Miete wurde darauf geachtet, dass die „wilde Mischung“ gut durchmischt und gleichmäßig aufgesetzt wurde. Die Temperatur dieser frisch aufgesetzten Miete lag bei 56°C - der Kompostierungsprozess ist hier in vollem Gange. Zum Vergleich: die Temperatur des fertigen Kompostes lag bei 8°C.

Abbildung 4: Abschlussbesprechung an den Kompostmieten des Kleinsägmühlerhof's (links: fertiger Kompost; rechts: frisch aufgesetzte Kompostmiete)
Fazit
Anhand der unterschiedlichen Ausgangsmaterialien der Kompostmieten der drei besuchten Projektbetriebe zeigte sich sowohl die Vielfalt als auch der Einfluss der verschiedenen Ausgangsmaterialien auf den Rotteprozess. Erste Erfahrung im Bereich der Beurteilung der Kompostqualität konnten in einem aktiven Austausch mit Gleichgesinnten und der Beratung gesammelt werden. Doch es zeigte sich auch, dass es bei der landwirtschaftliche Kompostierung noch immer viele offene Fragen gibt. Doch genau auf die Bewältigung dieser und noch weiterer Hürden, die bislang der Ausweitung der landwirtschaftlichen Kompostierung noch im Wege stehen, zielt das EIP-Projekt VELKO ab! Im weiteren Verlauf des Projektes geht es darum, Erfahrungen zu Kompostqualitäten und Messmethoden zu sammeln sowie Nährstoffeinträge in den Boden oder (Geruchs-) Emissionen zu untersucht. Dadurch sollten noch bestehende Vorbehalte ausgeräumt und der Weg für die landwirtschaftliche Kompostierung geebnet werden.
Zum Abschluss wurde den Teilnehmer*innen noch einen Sache mit auf den Weg gegeben: Probieren geht über Studieren! Es gibt kein allgemeingültiges Rezept für eine gute landwirtschaftliche Kompostierung, es geht vielmehr darum, sich mit dem System „Kompostierung“ vertraut zu machen und seinen individuellen Weg zu finden. Und hierbei stehen allen Interessierten die Projektteilnehmer aus Beratung und Praxis gerne zur Seite!
Aufgrund des großen Interesses an der Schulung sind weitere Schulungstermine – u.a. auch explizit für den Weinbau – geplant!
Weitere Informationen zum EIP-Projekt „Verbund landwirtschaftliche Kompostierung (VELKO) finden Sie auf der Projekt-Homepage unter https://www.soel.de/innerbetriebliche-kompostierung-velko.
Gefördert im Rahmen des Entwicklungsprogramms EULLE

In Zusammenarbeit mit:
     |